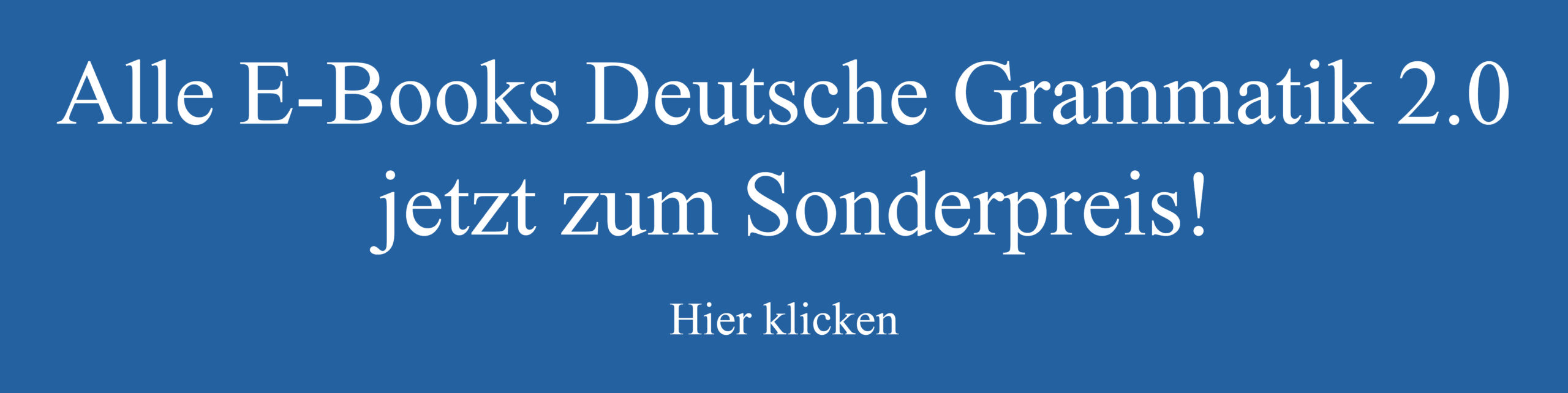Adversativsatz, der
Plural: die Adversativsätze
Weitere Begriffe: adversativer Nebensatz
Was ist ein Adversativsatz?
Ein Adversativsatz (im engeren Sinn) ist ein adversativer Nebensatz. Ein Adversativsatz beschreibt einen „Gegensatz“ zur Aussage eines anderen Satzes.
Adversativsätze bzw. adversative Nebensätze werden durch adversative Konjunktionen eingeleitet. Im Nebensatz steht das Verb am Ende. Eine adversative Konjunktion ist z. B. während.
Beispiel: adversative Beziehung zwischen zwei Sätzen (Gegensatz)
Maria hat die Prüfung bestanden. Ihr Freund hat die Prüfung nicht bestanden. / Ihr Freund ist durchgefallen.
„Aussage“ (Satz 1) – „Prüfung bestanden“
„Gegensatz“ (Satz 2) – „Prüfung nicht bestanden“, „durchgefallen“
Beispiel: adversativer Nebensatz mit während
Während Maria die Prüfung bestanden hat, ist ihr Freund durchgefallen.
Weitere adversative (Satz)verbindungen
Eine adversative Beziehung zwischen zwei Aussagen kann aber auch folgendermaßen ausgedrückt werden:
Adversative Hauptsatzverbindung
Zu den adversativen Hauptsatzverbindungen gehören z. B. Sätze mit der (Hauptsatz)konjunktion aber oder mit Konjunktionaladverbien wie dagegen, jedoch, demgegenüber, o.ä.
Beispiel: adversative Hauptsatzverbindung – aber
Maria hat die Prüfung bestanden, aber ihr Freund ist durchgefallen.
Beispiel: adversative Hauptsatzverbindung mit Konjunktionaladverb – dagegen
Maria hat die Prüfung bestanden. dagegen ist ihr Freund durchgefallen.
Adversative präpositionale Ausdrücke
Im Unterricht Deutsch als Fremdsprache werden auch häufig adversative präpositionale Ausdrücke zusammen mit den Adversativsätzen behandelt, obwohl es sich bei Präpositionalphrasen natürlich nicht um eigenständige Sätze handelt.
Beispiel: adversativer präpositionaler Ausdruck – im Gegensatz zu
Im Gegensatz zu Maria ist ihr Freund bei der Prüfung durchgefallen.
Im Gegensatz zu ihrem Freund hat Maria die Prüfung bestanden.
„Negative“* Adversativsätze mit anstatt dass/zu
Ein negativer* Adversativsatz mit anstatt beschreibt einen „negativen Gegensatz“ zur Aussage eines anderen Satzes. Der negative Gegensatz ist zugleich eine Handlungsempfehlung.
Beispiel:
Maria geht zur Arbeit. Sie bleibt nicht zu Hause.
„Aussage 1“ – „zur Arbeit gehen“
„negativer Gegensatz“ („Handlungsempfehlung“) – „nicht zur Arbeit gehen (zu Hause bleiben)“
=Maria geht zur Arbeit, aber sie sollte nicht zur Arbeit gehen.
=Maria sollte zu Hause bleiben, nicht zur Arbeit gehen.
Die Verbindung von Aussage und gegenteiliger Handlungsempfehlung kann man durch anstatt dass/zu ausdrücken.
Beispiel: anstatt zu
Maria geht zur Arbeit, anstatt zu Hause zu bleiben.
Der Konnektor anstatt kann in beiden verbundenen Sätzen stehen.
Beispiel:
Anstatt zu Hause zu bleiben, geht Maria zur Arbeit.
=Maria geht zur Arbeit, anstatt zu Hause zu bleiben.
*Beachte: Der negative Adversativsatz enthält keine Negation. Diese ist durch die Konjunktion anstatt ausgedrückt.
Welche adversativen Konjunktionen (Konnektoren) gibt es?
Zu den adversativen Konnektoren gehören z. B.:
Hauptsatzkonjunktionen: aber, doch, sondern
Nebensatzkonjunktionen: während
Konjunktionaladverbien: dagegen, jedoch
Außerdem drücken die folgenden präpositionalen Ausdrücke ein adversatives Verhältnis aus.
präpositionale Ausdrücke: Im Gegensatz (Unterschied, Vergleich) zu
Was ist der Unterschied zwischen Adversativsatz und Konzessivsatz?
Adversativsätze und Konzessivsätze sind ähnlich, aber nicht gleich. In beiden Satzarten geht es um gegensätzliche Aussagen. Aber Adversativsätze drücken einen (mehr oder weniger direkten) Gegensatz aus, Konzessivsätze eine Folge, die auf Grund der ersten Aussage nicht erwartet werden konnte („unerwartete Folge“).
Beispiel: (direkter) Gegensatz vs. unerwartete Folge
(direkter) Gegensatz: Maria hat die Prüfung bestanden. Ihr Freund ist bei der Prüfung durchgefallen.
unerwartete Folge: Maria ist heute krank. Sie geht zur Arbeit.
Beispiel: Adversativsatz vs. Konzessivsatz
Adversativsatz: Während Maria die Prüfung bestanden hat, ist ihr Freund durchgefallen.
Konzessivsatz: Obwohl Maria heute krank ist, geht sie (trotzdem) zur Arbeit.
Die Bedeutung von während
Während kann neben der adversativen Bedeutung auch temporale Bedeutung haben. Sie dazu und zur Unterscheidung von adversativer und temporaler Bedeutung:
Links zum Thema Adversativsatz
Zur adversativen Satzverbindung siehe auch: Modale Satzverbindung (IV) – adversative Satzverbindung: während, aber, demgegenüber
Zur konzessiven Satzverbindung siehe auch: Konzessive Satzverbindung: obwohl, aber, trotzdem, trotz
Zu einzelnen Konjunktionen und Konjunktionaladverbien siehe: Liste: Satzverbindung – alphabetisch
Zu einzelnen Präpositionen siehe ausführlich: Liste: Alle Präpositionen
Zu Nebensatzkonjunktionen siehe auch: Liste: subordinierende Konjunktionen
Zurück zum Grammatikglossar – A